Weed & Books:
Wissen Macht Frei
GEGEN DAS VERGESSEN & VERDRÄNGEN !
Gegen jegliche Ausprägung von Totalitarismen
WARNUNG: Bei Memorial International handelt es sich lt. Russischen Recht um eine TERRORISTISCHE ORGANISATION.
Vorträge und Co. zum Nachhören
Aus einer deutschnationalen Familie stammend, besuchten Harald und Irmfried das Gymnasium in Bregenz und studierten danach in Innsbruck – der eine Jus, der andere Medizin.
Beide engagierten sich als Burschenschafter und wurden illegale Nationalsozialisten.
Nach der Machtübernahme der Nazis machten sie Karriere:
Harald Eberl wurde als Rechtsanwalt Spezialist für Arisierungen und führender nationalsozialistischer Landespolitiker.
Irmfried Eberl leitete als Arzt „Heil- und Pflegeanstalten“, in denen Tausende Menschen ermordet wurden, bevor er als Kommandant des Vernichtungslagers Treblinka etwa 280.000 Tötungen verantwortete.
Nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Regimes tauchte Irmfried Eberl in Süddeutschland unter; 1948 wurde er verhaftet und nahm sich in der Haft das Leben.
Harald Eberl gelang es, sich der Entnazifizierung in Vorarlberg zu entziehen und im deutschen Wirtschaftswunder seine Karriere erfolgreich fortzusetzen.
Landesgeschichte im Gespräch anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages am 27. Jänner.
Sie gehören zu jenen Opfern des NS-Regimes, über die der Mann kaum spricht, die teilweise bis heute nicht als Opfer anerkannt werden: Männer, Frauen und Jugendliche, die als „Asoziale“ und „Kriminelle“ eingestuft wurden.
Die systematische Ausgrenzung dieser Menschen begann im austrofaschistischen Regime. Der NS-Staat schloss sie endgültig aus der „Volksgemeinschaft“ aus, inhaftierte sie in Heimen und Zwangseinrichtungen und schund sie vielfach in Konzentrationslagern zu Tode.
Der Historiker Gernot Kiermayr hat sich in seinem neuen Buch „Warum musste Oswald Schwendinger sterben?“ auf die Spur von als „Asoziale“ verfolgten Menschen gegeben.
Der im Montafon aufgewachsene Georg Friedrich Haas ist einer internationalen Abstimmung der italienischen Musikzeitschrift „Classic Voice“ zufolge der wichtigste lebende Komponist weltweit. In seiner im vergangenen Herbst erschienenen Autobiografie beschreibt Haas, wie er in einer Familie aufwuchs, die ihre Begeisterung für den Nationalsozialismus auch nach 1945 weiter pflegte und die ihn mit ihrer Ideologie regelrecht „vergiftete“. In freitags um 5 stellt der Komponist sein Buch erstmals in Vorarlberg vor – und erzählt, wie die einschlägigen Erlebnisse sein Leben und seine Musik geprägt haben.
Es sprechen Georg Friedrich Haas, Herausgeber des Buches Daniel Ender, freier Musikwissenschaftler und –publizist, sowie Roland Haas, der Bruder des Komponisten.
Moderation: Markus Barnay.
Über dieses Thema wurde lange getuschelt, meist einfach nur geschwungen hat: Die französische Armee, die 1945 Vorarlberg von der NS-Herrschaft befreite und dann mehrere Jahre lang besetzte, bestand unter anderem aus marokkanischen Soldaten. Sie hinterließen ein über viele Jahrzehnte tabuisiertes Erbe: Nachkommen mit ungewohnt dunkler Hautfarbe.
Die Autorin Ingrid Maria Kloser hat diesem Tabu eine Erzählung gewidmet, die Historikerin Renate Huber schildert den Umgang mit den Besatzern.
Tausende Flüchtlinge versuchten zwischen März 1938 und Mai 1945 über Vorarlberg die rettende Schweiz zu erreichen. Größtenteils Juden und Juden, aber auch politische Gegner*innen der Nazis, Intellektuelle, Deserteure, später auch Kriegsgefangene, Zwangs- und Fremdarbeiter*innen aus besetzten Ländern Europas versuchte die Flucht auf diesem Weg. Schon im Sommer 1938 begann die Schweiz, die Grenzen gegenüber den Flüchtlingen abzuriegeln.
Für diese gab es nun nur noch illegale Wege in die Freiheit. Nur wenige mutige Menschen waren bereit, den Flüchtlingen zu helfen. Eine dieser rühmlichen Ausnahmen war Ernest Prodolliet, der Schweizer Vizekonsul in Bregenz.
Die Bregenzer Krankenschwester Maria Stromberger unterstützte im KZ Auschwitz den dortigen Widerstand, wurde aber trotzdem 1945 in ein Haltelager für Nazis eingesperrt – bis hochrangige polnische Politiker für sie intervenierten. Jetzt erscheint die erste umfangreiche Biografie der Frau, die von ehemaligen Häftlingen als „Engel von Auschwitz“ bezeichnet wurde.
Harald Walser, Historiker und Verfasser der Biografie über Maria Stromberger, berichtet über seine Recherchen und seinen Zugang zur Geschichte Vorarlbergs.
Das Recht im Nationalsozialismus? Warum sollte uns dieses Thema interessieren? Einfach, weil es Fragen anspricht, die uns bewegen: Wie kann eine Demokratie zur Diktatur werden? Mit welchen Mitteln kann ein nach absoluter Macht strebendes Regime die Strukturen des Rechtsstaates beseitigen? Was bedeutet es, dass der "Führerstaat" die Einheit von Recht, Moral und Politik für sich beanspruchte? Was bedeutete das Rechtsystem für die Menschen in diesem System? Was galt für jene, welche Teil der "völkischen Gemeinschaft" waren? Was galt für jene, welche die Kriterien der Zugehörigkeit aus "rassischen Gründen" nicht erfüllten? Und wann und in welcher Form ging das NS-Regime von Diskriminierung in Gesetzesform zum Genozid über?
Ein Vortrag von Prof. Dr. Herlinde Pauer-Studer. Anschließendes Gespräch mit Dr. Alfons Dür, Richter, Präsident des Landesgerichts Feldkirch von 1998 bis 2008. Durch den Abend führt Dr. Petra Zudrell, Leiterin des Stadtmuseums Dornbirn
Adam Schmidtberger erzählt über seine Arbeit als Vermittler in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Gusen. Bei seinen Führungen spielt auch die eigene Familiengeschichte eine Rolle: Der große Bauernhof grenzte an das Areal des KZ Gusen. Wie gestalteten sich die Beziehungen zwischen Konzentrationslager und Gesellschaft?
Als sich der Eiserne Vorhang über Europa senkte, bestand auch für Österreich die Gefahr der Teilung. Der Historiker Günter Bischof präsentiert einen komprimierten Überblick über Österreich im Kalten Krieg – mit Fakten aus russischen, amerikanischen und neuen Archiven. Bischof, geboren 1953 in Mellau, ist Marshall Plan Chair und Direktor des Österreichzentrums an der Universität von New Orleans; Wissenschaftspreisträger des Landes Vorarlberg 2019.
Die sogenannten „Volksdeutschen“ waren eine verhältnismäßig kleine Zuwanderergruppe, die nach dem Kriegsende 1945 in Vorarlberg Zuflucht gefunden hat. Rund 2.000 Sudetendeutsche, Siebenbürger Sachsen und Donauschwaben wurden zunächst in Flüchtlingslagern, später auch in eigens errichteten Siedlungen untergebracht. Firmen wie Rieger Orgelbau in Schwarzach oder Kunert Strümpfe in Rankweil wurden von ihren ursprünglichen Niederlassungen in Schlesien bzw. Böhmen nach Vorarlberg verlegt. Die Historikerin Isabella Greber hat sich in ihrer Diplomarbeit mit diesen Zuwandern befasst, für den Psychoanalytiker Günther Rösel ist es Teil der eigenen Familiengeschichte. Der Orgelbauer Josef Glatter-Götz verlegte seinen Betrieb (Rieger) von Tschechien nach Schwarzach,
Das gesellschaftliche Bild von Rechtsextremen ist tief in den 1990er Jahren verankert: kahlgeschorene Männer in Springerstiefeln und Bomberjacken. Rechtsextreme stehen zwar immer noch im Fußballstadien, sie haben jedoch mit MMA (Mixed Martial Arts) und organisierten Hooligan-Fights ein weiteres Aktionsfeld erschlossen und werben um Kämpfer für den herbeigesehnten „Tag X“.
Dazu nutzen Sie vor allem das Internet – nicht nur Chat-Foren, sondern auch Videospiele. Jerome Trebing zeigt auf, wie sich die extremen Rechte in Deutschland, Österreich und Italien modernisiert haben. Nicht nur angesichts der Digitalisierung betont er die Rolle jedes einzelnen, dieser Weltanschauung und menschenfeindlichen Positionen im Alltag entgegenzutreten. Jerome Trebing studierte Soziale Arbeit und Soziologie, ist unter anderem Streetworker und für die Amadeu-Antonio-Stiftung in Deutschland tätig. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Modernisierung der extremen Rechten sowie deren internationale Vernetzung.
In Zusammenarbeit mit ÖGB Vorarlberg, erinnern.at und der Johann-August-Malin-Gesellschaft
Vortrag anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages am 27. Jänner
In den letzten Jahren ist ein zunehmendes Erstarken der (extremen) Rechte nicht nur in Österreich, sondern weltweit zu beobachten.
Der Vortrag von B. K. (Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes) widmet sich den verschiedenen Aspekten der Gegenwart, die einen Zustrom nach rechts begünstigen, und setzt diese in Verbindung mit politischen und gesellschaftlichen Kontinuitäten in Österreich. Neben individuellen Ursachen werden Faktoren wie Politiken der Angst und die Instrumentalisierung von Emotionen, spezifische Diskurse und Normalisierungen multipler Krisen und Destabilisierung thematisiert.
In Zusammenarbeit mit VÖGB-Vorarlberg, Renner Institut Vorarlberg, Johann-August-Malin-Gesellschaft, Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialdemokratie und _erinnern.at
"XX"
XXXX
Die Arolsen Archives sind ein internationales Zentrum über NS-Verfolgung mit dem weltweit umfassendsten Archiv zu den Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus.
Die Sammlung mit Hinweisen zu rund 17,5 Millionen Menschen beinhaltet Dokumente zu den verschiedenen Opfergruppen des NS-Regimes und ist eine wichtige Wissensquelle für die heutige Gesellschaft.
Die Sammlung gehört zum UNESCO-Weltdokumentenerbe.
Das Bundesarchiv hat im Jahr 2010 das Haftstättenverzeichnis der Stiftung EVZ übernommen und macht es über ein datenbankgestütztes Internetverzeichnis zugänglich.
Das Verzeichnis bietet Informationen zu rund 3.800 Lagern und Haftstätten, die im Rahmen der Auszahlungen an ehemalige Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen von der Stiftung EVZ berücksichtigt wurden. Die redaktionelle Verantwortung für das Verzeichnis liegt seit 2010 beim Bundesarchiv.
Auftrag der Stiftung EVZ ist es, die Erinnerung an das Unrecht der nationalsozialistischen Verfolgung lebendig zu halten und sich für Menschenrechte und Völkerverständigung einzusetzen.
Vor dem Hintergrund ihrer Gründungsgeschichte ist die Stiftung EVZ besonders in Mittel- und Osteuropa, Israel sowie in Deutschland aktiv.
Der KZ-Verband/VdA OÖ – mit vollem Namen „Landesverband Oberösterreich der AntifaschistInnen, WiderstandskämpferInnen und Opfer des Faschismus (KZ-Verband/VdA OÖ)“ – wurde nach der Befreiung Österreichs vom Faschismus als überparteilicher Verband im Jahre 1948 (wieder-)gegründet.
Der KZ-Verband/VdA OÖ vereint in seinen Reihen die Generation der WiderstandskämpferInnen und Opfer des Faschismus mit den jüngeren Generationen, die unter aktuellen Bedingungen bereit sind, den Kampf gegen Faschismus und Krieg fortsetzen.
Dennoch gibt es auch bei uns nur mehr wenige Überlebende, die aktiv gegen den Faschismus und für die Befreiung Österreichs gekämpft haben. Und so wie die zahllosen grausamen Verbrechen der Nazibarbarei nicht vergessen werden dürfen, so muß auch an den mutigen Widerstand der AntifaschistInnen erinnert werden.
Der Eichmann-Prozess war ein historisches Ereignis in der Geschichte Israels. Im Mai 1960 nahmen israelische Agenten Adolf Eichmann fest, der eine zentrale Rolle im Nazi-Plan zur Vernichtung von sechs Millionen europäischen Juden gespielt hatte, und brachten ihn nach Israel, um ihn dort vor Gericht zu stellen. Nachdem Ministerpräsident David Ben-Gurion die Festnahme Eichmanns bekannt gegeben hatte, begann die Polizei mit seinem Verhör. Der Prozess begann am 11. April 1961 vor einem Sonderausschuss des Bezirksgerichts Jerusalem. Sieben Monate später wurde Eichmann verurteilt und am 15. Dezember 1961 zum Tode verurteilt. Eichmanns deutscher Verteidiger, Dr. Robert Servatius, legte gegen das Urteil Berufung ein, die jedoch von den Richtern des Obersten Gerichtshofs abgelehnt wurde. Auch das an den Präsidenten Itzhak Ben-Tzvi gerichtete Gnadengesuch wurde abgelehnt, und in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni 1962 wurde Adolf Eichmann hingerichtet.
Die Dokumentation von Eichmanns Verhör und Prozess, darunter Filme der Verhandlungen und Manuskripte, die Eichmann im Gefängnis geschrieben hatte, wurden im israelischen Staatsarchiv hinterlegt. In den letzten Monaten hat das Archiv ein spezielles Projekt gestartet, um diese Materialien zu scannen, zu katalogisieren und sie nach Schlüsselwörtern durchsuchbar zu machen.
Die digitale Erinnerungslandschaft Österreichs (DERLA) ist ein Dokumentations- und Vermittlungsprojekt. Es dokumentiert österreichische Erinnerungsorte und -zeichen für die Opfer sowie die Orte des Terrors des Nationalsozialismus. Die kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der Erinnerung an ihn und seine Opfer ist das Hauptziel des Projektes.
Die vielfältigen Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus sind Ausdruck unseres politischen und gesellschaftlichen Selbstverständnisses in der Gegenwart. Dabei geben die Fragen, was, wann, wo und von wem wie erinnert wurde und wird, Einblick in die Veränderungen dieser Beschäftigung mit der NS-Zeit. „Gedächtnisorte“, Denk- und Mahnmäler, Gedenktafeln und Gedenkstätten sind sichtbare Zeichen von Geschichtsbewusstsein im Alltag. Die Erinnerungslandschaft in der Gegenwart beschreibt daher das kollektive Gedächtnis der österreichischen Gesellschaft und erzählt von der Beschäftigung sowie den Veränderungen der gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus seit 1945.
Projekt zur Österreichischen Erinnerungs- und Gedenkkultur als ein elementarer Diskursbeitrag
XX
XX
Aktualisierung: 25.Jannuar 2025






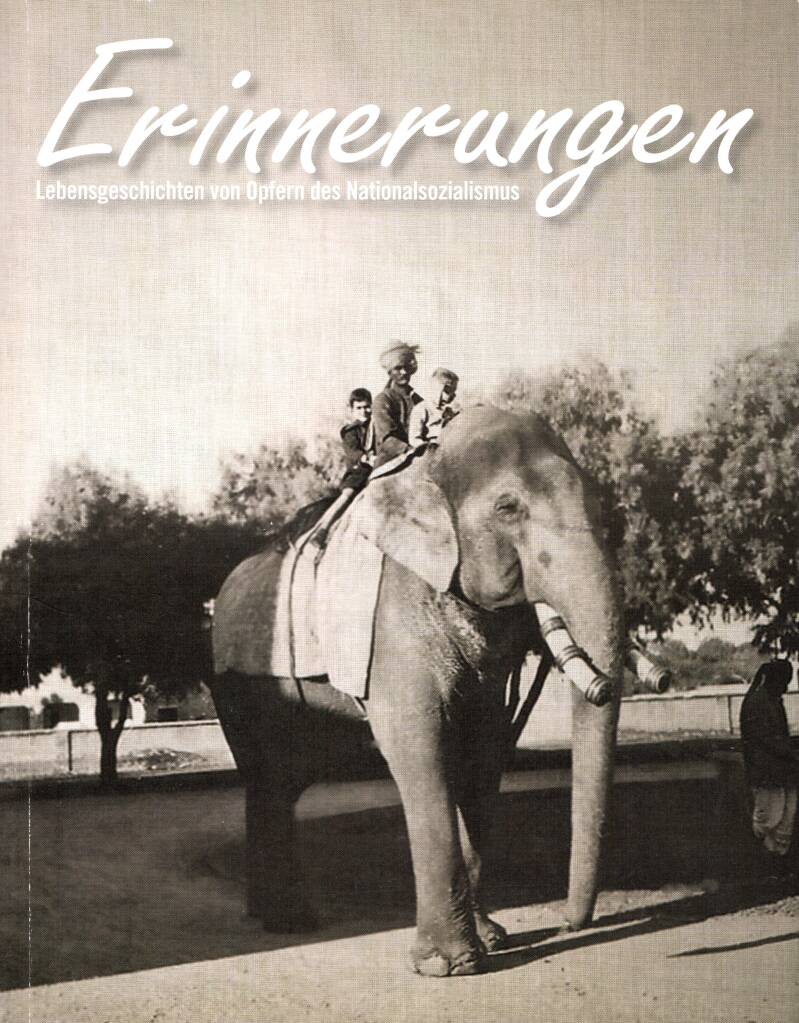




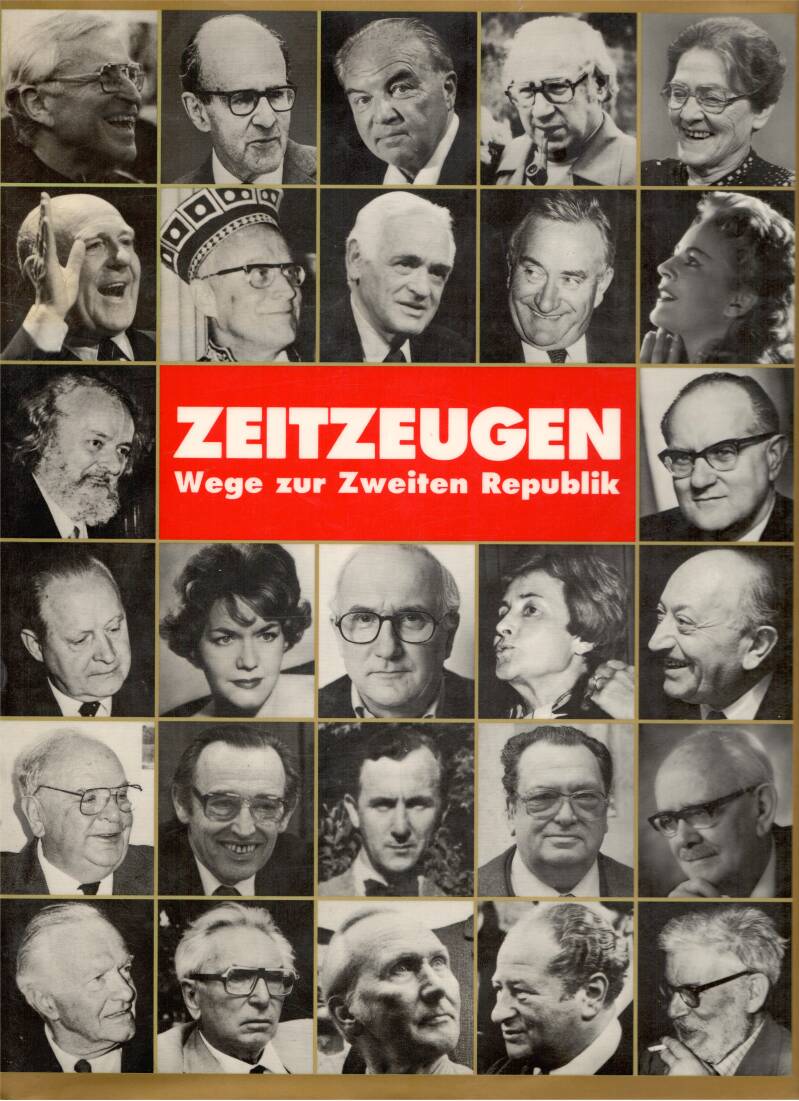






















Erstelle deine eigene Website mit Webador